
Naivität und ihre Folgen: Der Fall der Michaelsgemeinde in Darmstadt
Es gibt Ereignisse, die weit über das hinausgehen, was sie zunächst zu sein scheinen. Der Vorfall rund um den „antikolonialen Weihnachtsmarkt“ der evangelischen Michaelsgemeinde in Darmstadt gehört zweifelsohne dazu. Was zunächst wie ein Versuch aussah, gesellschaftskritische Akzente zu setzen, entpuppte sich als Bühne für israelbezogenen Antisemitismus und die Propaganda einer Terrororganisation. Doch wie konnte es dazu kommen, und was sagt das über den Zustand unserer Gesellschaft aus?
Der sogenannte „antikoloniale Weihnachtsmarkt“ wurde in Zusammenarbeit mit der Aktivistengruppe „Darmstadt 4 Palestine“ organisiert. Diese Gruppe nutzte die Plattform, um Symbole der Hamas, einer als terroristisch eingestuften Organisation, zu verbreiten. Produkte mit dem „Hamas-Dreieck“ und Slogans wie „From the river to the sea“ waren keine zufälligen Dekorationen. Sie sind klare Zeichen für eine Ideologie, die die Existenz Israels negiert und zu seiner Vernichtung aufruft.
Besonders beunruhigend ist, dass weder der verantwortliche Pfarrer Manfred Werner noch der Kirchenvorstand die Zeichen erkannten – oder erkennen wollten. Werner selbst behauptet, getäuscht worden zu sein, und führt an, dass er von den antisemitischen Botschaften auf dem Markt nichts mitbekommen habe. Doch selbst wenn man diese Aussagen wohlwollend betrachtet, bleibt die Frage: Wie konnte eine Gruppe mit so eindeutigen israelhassenden Motiven überhaupt Zugang zur Organisation eines solchen Events erhalten? Zudem stellt sich die grundlegende Frage, wie es möglich ist, dass eine christliche Kirche einen Weihnachtsmarkt als Plattform für derartige politische Themen missbrauchen lässt. Weihnachten ist doch im Kern ein Fest der Besinnung und des Friedens, das an die Geburt Christi erinnert. Sollte es hier nicht darum gehen, diese Botschaft der Liebe und Hoffnung zu verbreiten? Stattdessen wurde dieser zentrale Aspekt des Weihnachtsfestes durch ideologische Instrumentalisierung verdrängt. Dies deutet darauf hin, dass in Teilen des Christentums offenbar ein grundlegendes Verständnis für die eigentliche Bedeutung von Weihnachten verloren gegangen ist. Wie konnte es geschehen, dass der Fokus auf das Wesen des Glaubens derart abhandengekommen ist?
Ist Kritik berechtigt und notwendig?
Die Reaktionen auf diesen Vorfall waren scharf und vielstimmig. Sowohl die Jüdische Gemeinde Darmstadt als auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) stellten Strafanzeigen. Die Landeskirche suspendierte Pfarrer Werner vorläufig und forderte Aufklärung, während ein Mitglied des Kirchenvorstands zurücktrat, um weiteren Schaden von der Gemeinde abzuwenden. Auch die Stadt Darmstadt zeigte klare Kante und erstattete Anzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung.
Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker brachte es auf den Punkt: Dieser Vorfall sei ein trauriges Beispiel für die zunehmende Salonfähigkeit israelbezogenen Antisemitismus in Deutschland. Der Antisemitismusbeauftragte des Bundes, Felix Klein, ergänzte, dass der Diskurs über das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung zu oft von Israelhassern vereinnahmt werde – eine Entwicklung, die ehrliche und differenzierte Diskussionen nahezu unmöglich macht.
Auf dem "#Weihnachtsmarkt" der Evangelische #Michaelsgemeinde #Darmstadt #Martinsviertel wird der #Holocaust relativiert, zur Vernichtung des Staates #Israel aufgerufen und die #Hamas gefeiert.
— Tobias Huch (@TobiasHuch) December 16, 2024
Wie wird die @ekhn_de darauf reagieren, da auch diverse Strafanzeigen (§§ 86a, 130… pic.twitter.com/EoPHUyuBWk
Die gesellschaftlichen Dimensionen
Dieser Vorfall wirft Fragen auf, die weit über Darmstadt hinausgehen. Ist die Naivität der Michaelsgemeinde ein Einzelfall, oder spiegelt sie ein tieferliegendes Problem wider? Können wir sicher sein, dass ähnliche Ereignisse in anderen Gemeinden, Institutionen oder gesellschaftlichen Kontexten nicht ebenfalls vorkommen? Die Realität zeigt, dass sich Antisemitismus und Israelhass zunehmend hinter vermeintlich legitimen Anliegen wie Antikolonialismus oder Menschenrechtsdiskursen verstecken. Dies konnten wir auch jüngst bei Demonstrationen an Universitäten beobachten, wo Professoren und sogar die Hochschulleitungen ihre Solidarität mit Pro-Palästina-Aktivisten bekundeten. Diese Demonstrationen begannen oft als politische Kundgebungen, liefen jedoch aus dem Ruder und eskalierten in israelfeindliche Hetzreden. Die Situation verschärfte sich so weit, dass sich jüdische Studenten zunehmend bedroht fühlten und sich nicht mehr trauten, den Campus zu betreten. Berichte über antisemitische Schmierereien und offene Anfeindungen unterstreichen, wie bedrohlich die Lage für die betroffenen Studenten geworden ist. Dieser Zustand zeigt, wie gefährlich unkritische Unterstützung und mangelnde Kontrolle bei solchen Veranstaltungen sein können.
Diese Entwicklung ist besonders gefährlich, da sie oft von einem Mangel an Wissen und kritischem Bewusstsein begleitet wird. Viele Menschen erkennen die subtilen Anzeichen von israelbezogenem Antisemitismus nicht, sei es aus Ignoranz oder aus Angst, als voreingenommen abgestempelt zu werden. Diese Naivität schafft eine offene Flanke, die Gruppen wie „Darmstadt 4 Palestine“ gezielt ausnutzen.
Was werden die Konsequenzen sein?
Die Konsequenzen des Vorfalls in Darmstadt müssen klar und unmissverständlich sein. Es reicht nicht aus, dass einzelne Personen zurücktreten oder suspendiert werden. Notwendig ist eine breite gesellschaftliche Debatte über die Grenzen von Aktivismus und die Verantwortung von Institutionen, besonders wenn sie als Plattform für Extremismus missbraucht werden. Schulen, Kirchen, Vereine und politische Gruppen müssen sensibilisiert und geschult werden, um solche Missstände frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.
Zudem ist es an der Zeit, Antisemitismus in all seinen Facetten zu benennen und zu bekämpfen – sei es traditioneller Antisemitismus, israelbezogener Antisemitismus oder der Hass, der unter dem Deckmantel des „Friedensaktivismus“ daherkommt. Der Vorfall in Darmstadt zeigt, dass wir als Gesellschaft wachsam sein müssen. Es reicht nicht aus, antisemitische Übergriffe im Nachhinein zu verurteilen; wir müssen aktiv handeln, bevor sie geschehen.
Der Skandal um den „antikolonialen Weihnachtsmarkt“ der Michaelsgemeinde sollte uns nicht nur empören, sondern auch wachrütteln. Er zeigt, wie leichtfertig mit Symbolen und Botschaften umgegangen wird, die tiefgreifende gesellschaftliche Schäden verursachen können. Die Frage ist, ob wir diesen Weckruf ernst nehmen – oder ob wir weiterhin zulassen, dass Naivität und Gleichgültigkeit den Boden für Hass und Hetze bereiten.
Der Fall Darmstadt ist mehr als ein Einzelfall. Er ist ein Symptom einer Gesellschaft, die oft zögert, klare Grenzen zu ziehen. Es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass solche Vorfälle nicht zur Regel werden.

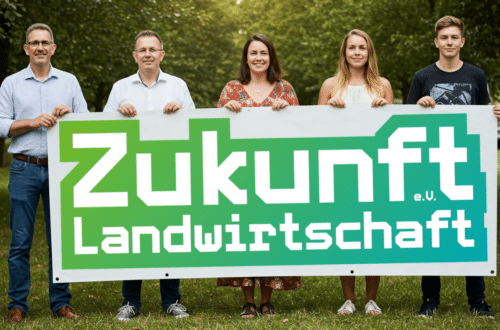

One Comment
Pingback: