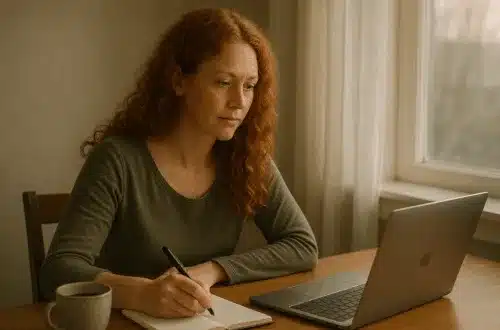Wenn der Zucker seine Macht verliert
Es ist schon verrückt, wie sich Gewohnheiten verändern können, wenn man sie einfach nicht mehr füttert. Früher war es bei mir ganz typisch: Abends, nach einem langen Tag, griff ich zur Schokolade. Und wenn ich sie erst mal geöffnet hatte, dann war klar, dass von der Tafel nichts übrigbleibt. Ich wusste genau, was passiert – und trotzdem tat ich es. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich merkte, dass mir das nicht guttut. Nicht körperlich, und auch nicht im Kopf. Also habe ich einfach aufgehört, Süßes zu kaufen. Ganz nach dem Motto: Was nicht im Haus ist, kann man auch nicht essen. Am Anfang war das komisch, fast wie ein Entzug. Aber dann wurde es leichter. Heute habe ich kaum noch Verlangen danach, und wenn ich doch mal etwas esse, dann ist mir das meiste einfach zu süß.
In den letzten Tagen habe ich einen Artikel in der „Apotheken Umschau“ gelesen, der mir einiges erklärt hat. Denn vieles, was wir für unsere eigene Entscheidung halten – was, wann und wie viel wir essen – läuft unbewusst ab. Es sind alte Programme, die in uns wirken. Manche stammen noch aus der Steinzeit, als unser Überleben davon abhing, energiereiche Nahrung zu finden. Süß bedeutete: Energie. Heute ist der Kühlschrank voll, aber unser Gehirn reagiert noch immer wie damals. Je häufiger wir Zucker essen, desto stärker verlangt der Körper danach.
Wenn Hunger und Hormone Regie führen
Der Körper ist ein faszinierendes System. Er sendet Signale, wann wir Hunger haben und wann wir satt sein sollten. Hormone wie Ghrelin, Leptin oder Insulin spielen dabei die Hauptrollen. Ghrelin weckt den Hunger, Leptin sorgt für das Gefühl der Sättigung, und Insulin hilft nicht nur beim Zuckerabbau, sondern wirkt auch auf das Belohnungssystem im Gehirn. Wenn dieses feine Gleichgewicht durcheinandergerät, geraten wir leicht in einen Kreislauf aus Appetit, Belohnung und Frust.
Gerade bei stark zuckerhaltigen Lebensmitteln passiert das schnell. Der kurze Kick von Dopamin lässt uns gut fühlen – aber nur für den Moment. Danach fällt der Spiegel ab, und das Verlangen beginnt von vorn. Manche Forscher sagen sogar, dass Zucker im Gehirn ähnliche Mechanismen auslöst wie Drogen. Und wenn man das so liest, versteht man plötzlich, warum es so schwer ist, einfach aufzuhören.
Ich finde diesen Gedanken tröstlich. Nicht, weil er eine Entschuldigung wäre, sondern weil er zeigt, dass wir uns selbst besser verstehen können. Ich war nicht willensschwach, wenn ich die Tafel Schokolade gegessen habe – ich war einfach ein Mensch, dessen Körper nach einem uralten Muster reagiert. Und genau da beginnt Veränderung: mit Verständnis.
Kleine Entscheidungen, große Wirkung
Heute fällt mir auf, wie viel Einfluss Kleinigkeiten haben. Wenn ich mit leerem Magen einkaufen gehe, ist die Versuchung größer. Wenn der Teller groß ist, nehme ich automatisch mehr. Wenn ich müde bin, greife ich lieber zu Fettigem oder Süßem. All das spielt sich im Hintergrund ab. Und doch kann man es steuern – nicht durch Zwang, sondern durch Bewusstsein.
Ich glaube, das ist der Schlüssel: zu erkennen, wann etwas von außen „an uns zieht“, und wann wir selbst entscheiden. Seit ich keine Süßigkeiten mehr im Haus habe, ist Ruhe eingekehrt. Kein innerer Kampf mehr, kein schlechtes Gewissen. Nur die Freiheit, es gar nicht erst zu wollen. Und das fühlt sich gut an – stark, auf eine ganz leise Art.
Entdecke mehr von Schimons Welt
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.